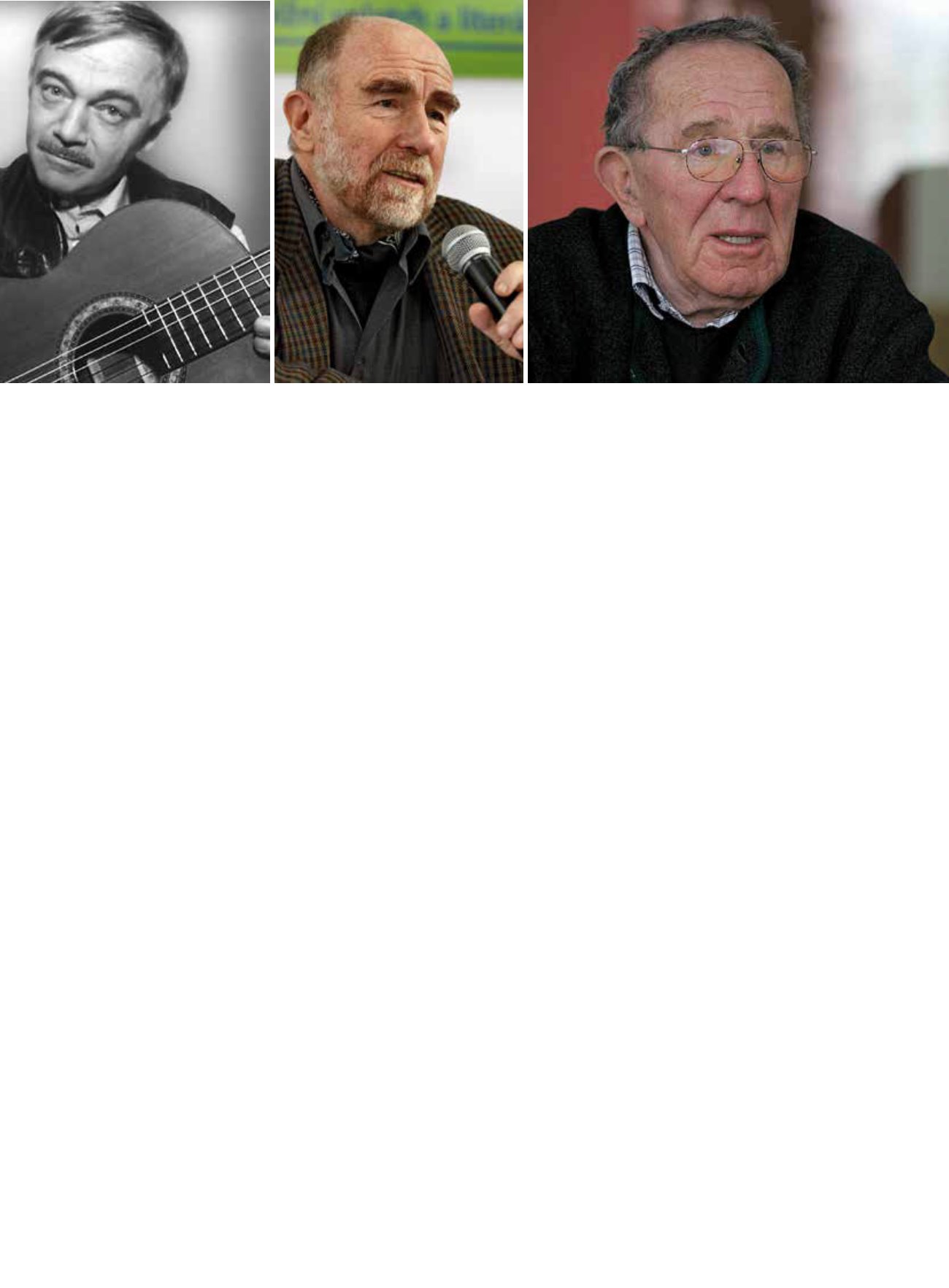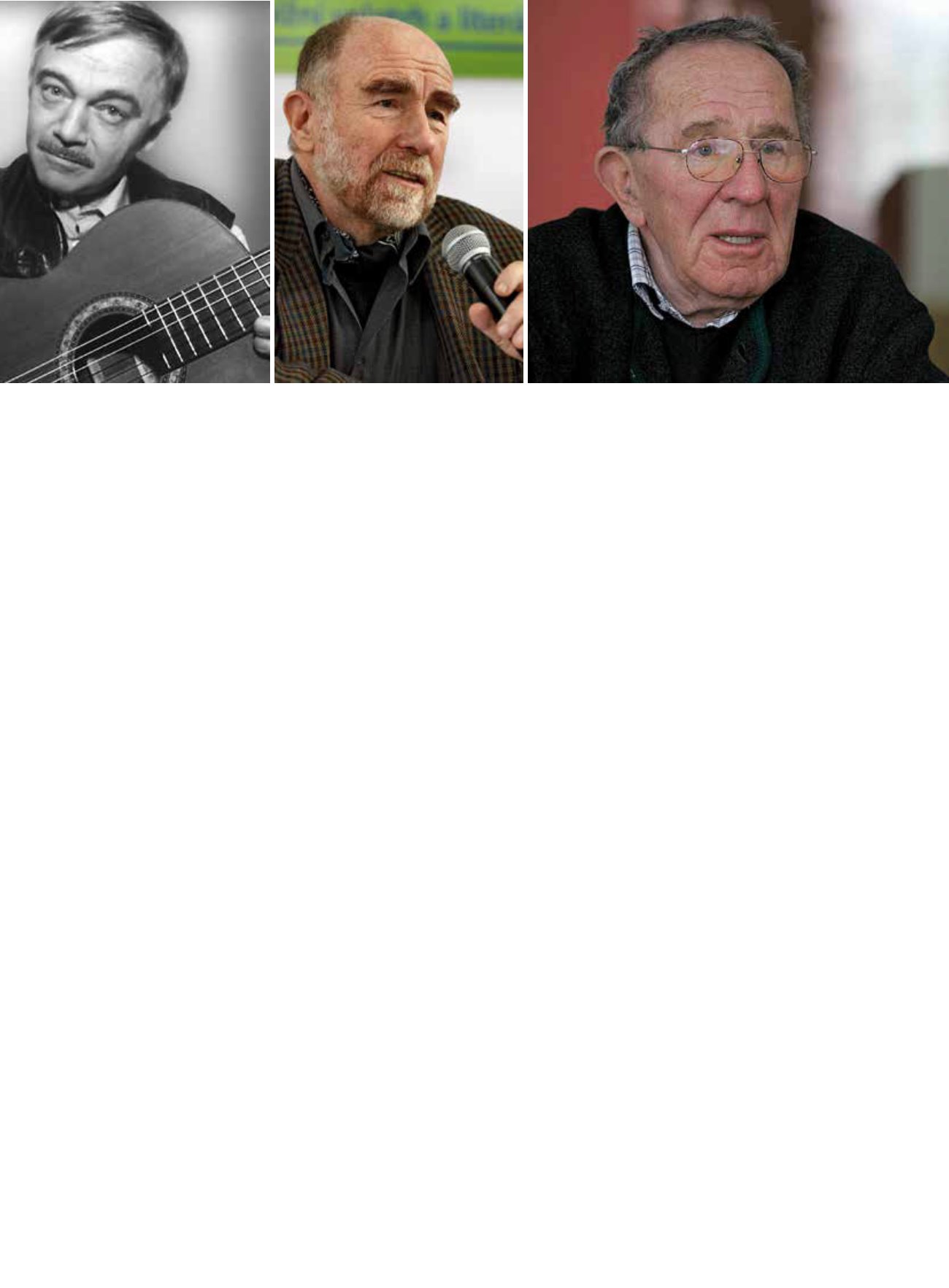
aviso 2 | 2015
Böhmen und Bayern
Colloquium
|27 |
des RFE. Neben journalistischen Texten verfasste er literatur-
und kulturgeschichtliche Essays. In München entstand sein
Roman »Krev není voda« (1991; auf Deutsch 2002 »Blut
ist kein Wasser«), eine Art Familienchronik und gleichzeitig
ein Bild des gebrochenen 20. Jahrhunderts. Jedlicˇka starb
nach einer längeren Krankheit in Augsburg, wo er mit sei-
ner zweiten Frau Viola Fischerová (1935–2010), Dichterin,
Übersetzerin und ebenfalls RFE-Mitarbeiterin, lebte; er ist
dort auf dem Neuen Ostfriedhof begraben.
Typisch, dass die Landsleute am abscheulichsten sind
An der Entstehung der Romanchronik von Jedlicˇka hatte
sein Freund nicht unerheblichen Anteil, der Dichter Ivan
Diviš (1924–1999): Er hatte Jedlicˇka ermuntert, weiter am
ursprünglich nur für private Zwecke gedachten Text zu arbei-
ten. Auch Diviš kam bereits 1968 nachMünchen – er wohnte
hier u. a. in der Gebelestraße – und wurde beimRFE als Bib-
liothekar angestellt; seine Beiträge für die Sendungen schrieb
er auf Honorarbasis. Seine Lebensgeschichte ist beispiel-
haft für die Tragik eines Schriftstellerschicksals im Exil. In
Tschechien ein fruchtbarer Autor, hat ihn in München seine
schöpferische Kraft verlassen. Als er wieder schreiben konn-
te, war sein Leserkreis deutlich reduziert. Die einzige deut-
sche Übersetzung seines Werks, die Sammlung »Sursum«
(1967, ergänzt 1986), erschien paradoxerweise erst 1995. Seine
Situation reflektierte Diviš in den Aufzeichnungen »Teorie
spolehlivosti« (1994; »Theorie der Verlässlichkeit«), einem
brisanten und ergreifenden literarischen Zeugnis: »Ich habe
in Deutschland nichts zu tun, niemand will hier was von mir,
weder in der dichterischen Sphäre noch in der bürgerlichen,
niemand will das, wofür ich stehe, und es ist typisch, dass die
Landsleute von allen am abscheulichsten sind« (28. Okto
ber 1971). Nach der Wende erwog er lange die endgültige
Rückkehr nach Prag. 1997 war es so weit; zwei Jahre lang
genoss er den Ruhm, die öffentliche Aufmerksamkeit, die er
dank seiner expressiven Art auf sich zog und die eine andere
war als in München, wie die Autoren seines Nachrufs etwas
hyperbolisch schreiben: »Vielleicht der einzige Gewinn, den
das Exil Diviš brachte, war die Anonymität. Er fuhr mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln durchMünchen und traktierte
die gesetzten bayerischen Bürger mit saftigen Beschimpfun-
gen. In dortigen Kaufhäusern beging er zahllose Verstöße. Er
hasste den Gedanken, mit einer Rückkehr nach Prag diese
Freiheit zu verlieren.« Er starb in Prag nach einem Treppen-
sturz im eigenen Haus.
München ist keine schöne Stadt, aber man fühlt
sich hier wohl
Karel Kryl (1944–1994) war in Tschechien ein populärer Lie-
dermacher und eine Symbolfigur des Widerstands nach dem
Einmarsch der Warschauer Truppen. 1969 kam er über Bad
Aibling nachMünchen, wo er mit demRFE zusammenarbei-
tete. Eine Festanstellung bekam er erst 1983 als Sport- und
Musikredakteur. Er zog mehrmals um, wohnte im ungari-
schen Studentenwohnheim Paulinum in der Rambergstra-
ße 6 und dann im ehemaligen olympischen Dorf. Schließlich
landete er in der Preysingstraße 29: Die Gelateria Adamello
im Erdgeschoss, die er in »Kneipe bei Max« umtaufte und
die zu seinem Stammlokal wurde, verewigte er in einigen sei-
ner Gedichte. Über seine Beziehung zu München schrieb er:
»München ist ein fünfundvierzigjähriger leidenschaftlicher
Biertrinker, ein Chauffeur, der nach der Schicht sein Bier trin-
ken will. Er ist nicht mehr so hübsch, hat einen Bauch, aber
er ist prima. München ist keine schöne Stadt, aber man fühlt
sich hier wohl. Mit so einemKumpel kann man Bier trinken
und reden. Das ist München.« Kryl beteiligte sich intensiv
von links
Der Dirigent Rafael Kubelík.
Der Schriftsteller Ivan Diviš.
Der Liedermacher Karel Kryl.
Der Schriftsteller Ivan Binar beim Literaturfestival
LIBRI 2009 in Olomouc/Olmütz.
Der Schriftsteller Ota Filip.
©idisclassica.com/baobab-books.net/Tschechisches Zentrum München © denik.cz; dk-kromeriz.cz/Wikipedia Commons, Foto: Martin Kozák/Foto: Monika Tomášková//zpravy.idnes.cz MF DNES
für Informatik der Ludwig-Maximilians-Universität München.